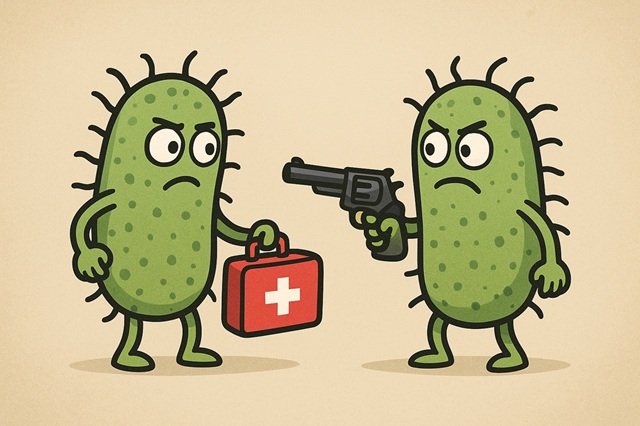So unterschiedlich können Forschungsergebnisse sein. Zwei Arbeitsgruppen untersuchten den Einfluss von Ruminococcus torques auf Stoffwechselstörungen und kamen zu sehr gegensätzlichen Ergebnissen. Beide haben wohl recht und den Unterschied macht ein winziges Detail – aber der Reihe nach…
Ruminococcus torques ist ein gängiges Darmbakterium, das fast überall mit einer Populationsstärke von bis zu einem Prozent vorkommt. Es wird mit entzündungsfördernden Prozessen in Verbindung gebracht und ist möglicherweise am Verlauf entzündlicher Darmerkrankungen, also Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, beteiligt. Eigentlich hat Ruminococcus torques schon einen schlechten Ruf. An dem müsste er nicht mehr arbeiten, aber ein bisschen mehr geht halt immer.
Ruminococcus torques gehört zu den Mucin abbauenden Bakterien. Das ist an sich noch gar nicht schlecht. Das macht Akkermansia muciciphila auch – aber sie schadet der Darmschleimhaut nicht. R. torques gehört zu der Truppe, die die Mucosa verdünnen und damit ihre Schutzfunktion schwächen. Das liegt vielleicht daran, dass R. torques gut mit Enzymen ausgestattet ist, die die Mucosa angreifen können. Davon profitiert übrigens Bacteroides thetaiotaomicron, der die halbverdauten Abbauprodukte für sich selbst nutzt. R. torques füttert B. thetaiotaomicron und der gehört zu den Butyratbildnern, den Guten also.
Ruminococcus torques macht Dicke krank
Viele von uns sind ziemlich dick und Fettleibigkeit ist eine echte Krankheit. Aber nicht alle Dicken sind auch tatsächlich krank. Nur etwa 70 %, die übrigen 30 % sind metabolisch gesund. Und weil Darmbakterien eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Stoffwechselstörungen spielen, vermuteten Forschende aus China, dass bakterielle Stoffwechselprodukte einen Einfluss auf den Gesundheitszustand ihrer Wirte haben könnten.
Im Detail forschten sie nach unterschiedlichen bakteriellen Metaboliten, die sie im Stuhl von gesunden und kranken Übergewichtigen finden würden. Die Forschenden rekrutierten 88 übergewichtige Probanden, von denen 52 gesund waren, während bei 36 bereits unter einer Insulinresistenz litten.
Tatsächlich fanden sie zwischen den beiden Gruppen Unterschiede in der Verteilung der Darmbakterien. Im Stuhl der insulinsresistenten Probanden fanden sie unter anderem eine erhöhte Anzahl an Ruminococcus torques. Kann es da einen Zusammenhang geben?
Was machen die da?
Die Forschenden verabreichten Mäusen Ruminococcus torques und die reagierten prompt mit einem beeinträchtigten Zuckerstoffwechsel, ihre Leber vergrößerte sich und sie bildeten vermehrt Enzyme zur Fettsynthese und legten an Gewicht zu. R. torques störte ganz eindeutig die Signalübertragung durch Insulin.
Wie machen die das?
Es ist sehr wahrscheinlich, dass Ruminococcus torques diese Wirkung über irgendein Stoffwechselprodukt ausübt. Also suchten die Forschenden nach Metaboliten im Stuhl, die bei insulinresistenten Probanden vermehrt auftraten.
Sie entdeckten eine Korrelation zwischen R. torques und Mevalonolacton.
Mevalonolacton ist ein Zwischenprodukt der Synthese von Isoprenoiden, die wiederum Bestandteil von Cholesterin und anderen Steroiden sind. Die meisten Bakterien verfügen nicht über diesen Stoffwechselweg. Ruminococcus torques anscheinend schon.
Im Blut der insulinresistenten Probanden fand man erhöhte Mengen an Mevalonolacton und auch im Blut von Mäusen, denen man R. torques verabreicht hatte. Und insgesamt verursacht die Gabe von Mevalonolacton dieselben Komplikationen wie R. torques persönlich.
Es zeigte sich auch, dass Mevalonolacton in der Leber der Mäuse hunderte Gene an- oder abschaltete. Davon waren vor allem die Gene für den Glucose- und Fettstoffwechsel betroffen. Und hier wiederum die Cholesterinsynthese und der Triglyceridstoffwechsel. Außerdem führte Mevalonolacton die Leber in die Insulinresistenz. Mevalonolacton wirkt sich gleich auf mehrere Signalwege aus.
Wie kann dieses eine Molekül so eine große Wirkung haben?
Die Forschenden bearbeiteten und erforschten jeden neuen Puzzlestein und deckten zuletzt die ganze Geschichte auf:
Mevalonolacton bindet an einen Transkriptionsfaktor. Das ist ein Protein, das die Aktivität von Genen reguliert. Durch die Bindung von Mevalonolacton wandert der in den Zellkern und setzt sich in den Promotor, den regulatorischen Bereich, seines Zielgens und setzt dadurch die ganze Kaskade in Gang.
Mevalonolacton führt zu Insulinresistenz, weil es die Aktivität eines Gens steigert, dessen Produkt andere Proteine verändert, die daraufhin wiederum verschiedene Signalwege beeinflussen.
Was mir dazu einfällt:
Wir produzieren dieses Zwischenprodukt der Cholesterinsynthese auch selbst. Wenn es zu Stoffwechselstörungen führen kann, wäre es dann nicht geschickter, Cholesterin mit der Nahrung aufzunehmen und die eigene Synthese und damit den Störfaktor herunterzufahren? Nur so ein Gedanke.
Diese Arbeit erschien im Mai 2025. Und im Juli 2025 kommen die nächsten und finden etwas ziemlich anderes. Diese dänisch-chinesische Koproduktion stellt fest, dass bestimmte Proteine eben dieses Ruminococcus torques den belasteten Stoffwechsel verbessern können:
Ruminococcus torques macht Dicke dünn
Diese Forschenden durchstöberten Datenbanken nach bakteriellen Genen, deren Produkte möglicherweise zu Liganden aus dem menschlichen Stoffwechsel passen könnten. Also im Prinzip bakterielle Kopien menschlicher Signalmoleküle.
In manchen Stämmen (Stämme bezeichnet hier Untergruppen einer Art) von Ruminococcus torques fanden sie ein Protein, RUMTOR_00181, das vom Gen rumtor_00181 codiert wird. Das Gen rumtor_00181 codiert für zwei Peptide, RORDEP1 und RORDEP2, die von manchen Ruminococcus trorques Stämmen produziert werden. Sie haben eine gewisse Ähnlichkeit zu einem menschlichen Hormon, dem Irisin.
Irisin ist das „Sporthormon“, ein Myokin, ein Botenstoff, der bei körperlicher Aktivität in den Muskelzellen gebildet wird. Es soll an der Regulation des Energiestoffwechsels beteiligt sein und die Umwandlung von weißem in braunes, also Energie verschwendendes, Fettgewebe fördern. Außerdem soll es einen Einfluss auf viel andere Körperfunktionen haben.
Wo kommt dieses Gen vor?
Die Forschenden fanden nun eine umgekehrte Korrelation zwischen der Häufigkeit dieser Peptide und dem BMI. Je weniger RORDEP1 und RORDEP2 vorhanden, desto mehr Gewicht bringen die Träger auf die Waage.
Ruminococcus torques ist ein häufiges Darmbakterium, das bis zu 1 % der Bakterien ausmachen kann. Über 90 % der Menschen tragen R. torques, aber nicht alle Bakterien enthalten das Gen, das für die RORDEPS codiert. In einer Studie trugen aber alle gesunden, schlanken Probanden Stämme mit dem RORDEP-Gen.
Die Ernährung macht hier keinen Unterschied, egal ob vegan oder omnivor, die Verteilung der RORDEP Stämme unterscheidet sich nicht. Schade – wäre schön, wenn man sie füttern könnte.
RORDEPS verbessern den Stoffwechsel
Forschende verabreichten Versuchstieren über mehrere Wochen einen RORDEP exprimierenden Stamm von R. torques. Nach der Behandlung hatte sich die Glucosetoleranz verbessert und die Gewichtszunahme verringert. Fett war verschwunden.
Weißes Speicherfett hatte sich in braunes, Wärme produzierendes verwandelt, wie die Zunahme von entsprechenden Markerproteinen zeigte. Die Aktivität der Gene für die Neubildung von Fett hatte dagegen abgenommen, die der Fett abbauenden Enzyme zugenommen. Die Entzündungsmarker waren gesunken.
RORDEP1 lässt den Spiegel Blutzucker regulierende Homone ( GLP-1, PYY und Insulin) im Plasma ansteigen. Die Glucoseproduktion in der Leber sinkt, die Insulinsensitivität verbessert sich.
RORDEPS verändern den Stoffwechsel der Leber
Auch diese Forschungsgruppe hat sich die Aktivität der Leber unter ihren Versuchsbedingungen angesehen. Sie finden über 2000 Gene, und knapp 400 Proteine, die in ihrer Aktivität von RORDEPs abhängen. Sie gehören zu 85 verschiedenen Stoffwechselwegen.
RORDEPS hemmen demnach die Gluconeogense (Neubildung von Glucose), die Lipogenese (Neubildung von Fett) sowie den Abbau von Glycogen. Die Gene und Proteine für die Glycolyse (Abbau von Glucose) und Glycogenbildung sowie die Signalübertragung durch Insulin werden dagegen aktiviert.
Diese RORDEPS verbessern also den Glucosestoffwechsel.
Das ist ziemlich genau das Gegenteil der Ergebnisse der ersten Gruppe. Der einzige Unterschied scheint die Anwesenheit dieses einen Gens rumtor_00181 zu sein. Die haben sicher noch viel Diskussionsbedarf…
Quellen:
Fan Y, Lyu L, Vazquez-Uribe R, Zhang W, Bongers M, Koulouktsis A, Yang M, Sereika-Bejder V, Arora T, Stankevic E, Armetta J, Zosel F, de la Cour CD, Simonsen L, Kulakova A, Wierer M, Harris P, Gæde J, Rossing P, Knop FK, Pers TH, Hansen TH, Nielsen T, Li L, Strømgaard K, Yang G, Sommer MOA, Pedersen O. Polypeptides synthesized by common bacteria in the human gut improve rodent metabolism. Nat Microbiol. 2025 Aug;10(8):1918-1939. doi: 10.1038/s41564-025-02064-x. Epub 2025 Jul 31. PMID: 40745048; PMCID: PMC12313525.
Nie HY, Zhao MF, Wu TY, Zou MJ, Tang YP, Wang XC, Wang NN, Zhou ZY, Bi Y, Zhao Y, Sun XT, Zhang JZ, Fang L, Li CJ. Elevated mevalonolactone from Ruminococcus torques contributes to metabolically unhealthy obesity development. J Biol Chem. 2025 Jun;301(6):110281. doi: 10.1016/j.jbc.2025.110281. Epub 2025 May 22. PMID: 40412522; PMCID: PMC12214271.
Schaus SR, Vasconcelos Pereira G, Luis AS, Madlambayan E, Terrapon N, Ostrowski MP, Jin C, Henrissat B, Hansson GC, Martens EC. Ruminococcus torques is a keystone degrader of intestinal mucin glycoprotein, releasing oligosaccharides used by Bacteroides thetaiotaomicron. mBio. 2024 Aug 14;15(8):e0003924. doi: 10.1128/mbio.00039-24. Epub 2024 Jul 8. PMID: 38975756; PMCID: PMC11323728.