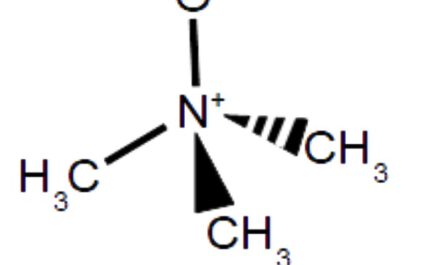Unsere kommensalen Darmbakterien sind nicht zuletzt deswegen so nützlich und liebenswert, weil sie Pathogene daran hindern, sich niederzulassen. Man nennt das Kolonisationsresistenz. Dieses Phänomen beruht der Konkurrenz um Ressourcen innerhalb der Bakteriengesellschaft und auf Aktionen des Immunsystems. Das Gefüge kann nur gut funktionieren, wenn sich alles im Gleichgewicht befindet. Werden Mitglieder Gesellschaft in ihrem Alltag gestört, verändert sich ihre Populationsstärke und das kann pathogenen Bakterien den Einzug in die Gesellschaft ermöglichen.
Klar ist, dass Antibiotika die Bakteriengesellschaft ordentlich durcheinander bringen. Schließlich ist es die Aufgabe der Antibiotika, Bakterien zu töten. In der Vergangenheit hat sich aber kaum jemand Gedanken darüber gemacht, was Medikamente im Allgemeinen mit dem Darm-Mikrobiom anstellen. Schließlich richten sie sich gegen die Zellen und Gewebe des Wirts. Allerdings sind manche Ziele und Funktionen so konserviert, dass sie auch in Bakterienzellen schon wirken.
Nicht-Antibiotika aus fast allen Wirkstoffklassen können kommensale Darmbakterien am Wachstum hindern. Dann ändert sich die Zusammensetzung des Mikrobioms. Es kann zu einer Dysbiose kommen. Die Kolonisationsresistenz geht verloren und das ebnet Pathogenen den Weg in die Gesellschaft.
Pathogene lassen sich von Medikamenten nicht beeindrucken
Das Wachstum unserer kommensalen Darmbakterien wird durch verschiedenste Medikamente gehemmt. Forschende wollte nun wissen, ob das auch für die weniger gern gesehenen Pathogenen gilt. Sie untersuchten den Effekt von mehr als 1000 Wirkstoffen aus verschiedenen Anwendungsbereichen auf das Wachstum von verschiedenen Vertretern von Gamma-Proteobakterien und verglichen sie mit dem Verhalten der Kommensalen.
Antibiotika hemmten das Wachstum von kommensalen und pathogenen Bakterien in gleichem Maß. Den pathogenen Bakterien machten die nicht-antibiotischen Wirkstoffe weniger aus, aber die kommensalen wurden bei mehr Wirkstoffen und das schon bei geringerer Konzentration im Wachstum gehemmt.
Zu den Gamma-Proteobakterien gehören die klassischen Darmbakterien, die man schon seit langem kennt, unter anderem die Gattungen Salmonella, Yersinia (eine Verwandte des Pesterregers), Haemophilus, Shigella oder Vibrio.
Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie durch ihre doppelte Zellhülle geschützt sind. Die haben aber alle sogenannten Gram-negativen Bakterien – und das sind viele und es gehören auch „gute“ dazu, zum Beispiel Bacteroides. Aber die Gamma-Proteobakterien besitzen auch leistungsfähige Effluxsysteme, mit deren Hilfe sie unerwünscht in die Zelle gelangten Inhalt wieder nach außen abgeben können.
Da gibt es zum Beispiel die Effluxpumpe TolC. Wenn man sie den Bakterien wegnimmt, indem man die entsprechenden Gene inaktiviert, steigt die Sensitivität der unglücklichen Mutanten deutlich und stärker als in entsprechenden Mutanten von kommensalen Bakterien. Ein eindeutiger Effekt, aber da muss noch mehr dahinter stecken – vielleicht unterschiedliche Substratspezifität. Pathogene sind schließlich an harsche Umweltbedingungen gewöhnt und brauchen gut funktionierende Instrumente.
TolC ist übrigens auch der Transporter, durch den E.coli im Zellinneren angehäufte PFAS wieder entsorgen.
Medikamente fördern die Vermehrung von Pathogenen
Es scheint nicht nur so zu sein, dass Pathogene von Medikamenten weniger in ihrem Treiben gestört werden. Die Wirkstoffe schienen die Verbreitung dieser Bakterien noch zu fördern. Das untersuchten die Forschenden an einem künstlichen Darm-Ökosystem, das nur 20 der wichtigsten Darmbakterien enthielt. Nachdem sie diese Kultur den Wirkstoffen ausgesetzt hatten, gaben sie Salmonella dazu. In der Kontrollkultur, die nicht mit Medikamenten behandelt worden war, konnte sich Salmonella nicht vermehren.
Auf diese Weise testeten sie 53 Wirkstoffe. Davon förderten 15, das entspricht knapp 30 %, das Wachstum der Salmonellen. Nur zwei Wirkstoffe hemmten die Vermehrung der Salmonellen, aber nur ib der künstlichen Mischkultur, nicht, wenn Salmonella alleine damit konfrontiert wurde. Es scheint sich also um einen indirekten Effekt zu handeln.
Unter Bedingungen, die das Wachstum von Salmonella förderten, gediehen die andern Bakterien nicht so gut. Der Effekt war gar nicht so groß. Er genügte aber aus, das Gleichgewicht der Gesellschaft zu kippen und die Kolonisationsresistenz auszuhebeln.
Diesen Effekt gibt es auch bei anderen Gamma-Proteobakterien, nicht nur bei Salmonella. Viele Medikamente stören die Kolonisationsresistenz, die kommensale Darmbakterien den pathogenen entgegensetzt.
Veränderungen des Mikrobioms können Pathogene fördern
Die Zusammensetzung der Bakteriengesellschaft, die sich nach der Medikamentenbehandlung verändert, kann die Verbreitung von pathogenen Bakterien begünstigen. Zum Beispiel zeichnen sich Gesellschaften, die die Vermehrung von Salmonellen nicht fördern, dadurch aus, dass aus ihnen bestimmte kommensale verschwunden sind. Entfernt man diese Bakterien gezielt aus der künstlichen Gesellschaft hat das denselben Effekt und die Salmonellen können nicht siedeln. Das Fehlen dieser Bakterien schränkt übrigens auch das Siedlungsverhalten anderer, verwandter Pathogenen ein. Da scheint es sich wohl um eine Kooperation zu handeln.
Aber es gibt auch das Gegenteil. Wenn durch die Wirkung der Medikamente Bakterien verschwinden, wird ihre ökologische Nische frei und kann neu besetzt werden.
Auch das zeigten die Forschenden, indem sie einen E. coli Stamm mit Eigenschaften, die denen der Salmonellen sehr ähnlich sind, zu der künstlichen Bakteriengesellschaft gaben.
Durch die Zugabe der neuen Art erhielt die Gesellschaft ein reichhaltigeres „Metabolom“, konnte also mehr verschiedene Stoffwechselprozesse durchführen. Schon dadurch alleine bekamen die Salmonellen auch ohne Medikamentenbehandlung Schwierigkeiten.
Die Colibakterien machten es den Salmonellen schwer, sich anzusiedeln, denn sie besetzten die von den Salmonellen angestrebte Nische.
Wenn die Forschenden nun gezielt gegen E. coli vorgingen, vermehrten sich die Salmonellen – sie hatten endlich eine freie Wohnung gefunden 😉 . Wirkstoffe, die die Vermehrung von E. coli förderten, ließen die Salmonellenpopulationen schrumpfen. Das zeigt nochmal, dass es die colis sind, die den Salmonellen das Siedeln erschweren.
So sieht’s aus:
Die Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass sich durch die Medikamente die Häufigkeit eines Nischenkonkurrenten verändern kann. Das wirkt sich auch auf die Ausbreitung von Pathogenen in der mikrobiellen Gemeinschaft aus. Hemmt das Medikament den Kommensalen, hat der Pathogene gute Chancen sich zu vermehren.
Unterschiede in der Empfindlichkeit gegenüber Medikamenten entscheiden darüber, ob der Inhaber oder Herausforderer die Nische besetzt. Insgesamt führt das zu Veränderungen der Gesellschaft der Darmbakterien.
Die Medikamente verändern das Mikrobiom auf verschiedenen Wegen. Sie reduzieren die Biomasse oder die Artenvielfalt – oder beides. Manche Arten werden von bestimmten Wirkstoffen ganz gezielt angegriffen. Dann sinkt der Konkurrenzdruck und ein robusteres Pathogenes kann es sich vermehren.
Quelle:
Grießhammer, Anne et al. “Non-antibiotics disrupt colonization resistance against enteropathogens.” Nature, 10.1038/s41586-025-09217-2. 16 Jul. 2025, doi:10.1038/s41586-025-09217-2
Bild von Pasi Mäenpää auf Pixabay