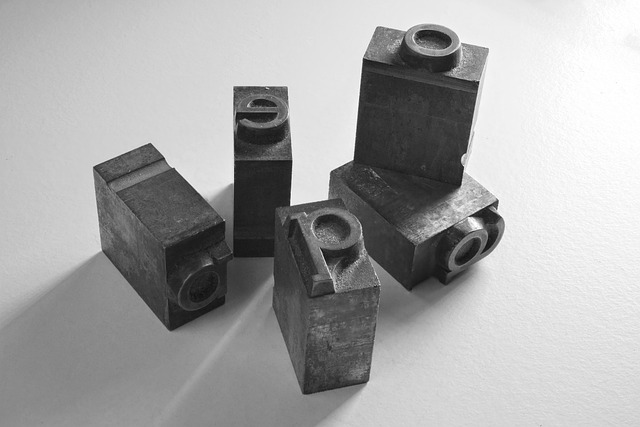Schwermetalle sind giftig, das wissen wir. Sie reichern sich in verschiedenen Organen an und verdrängen Mineralstoffe aus ihrer Position, an der sie eigentlich wichtige Funktionen für unseren Stoffwechsel erledigen sollten. Blei kann Calcium verdrängen, Cadmium Zink. Calcium ist ein wichtiger Signalstoff, Zink in vielen Proteinen an deren Aktivität beteiligt. Die Folge können oxidativer Stress, chronische Entzündungen, Nierenschäden, Bluthochdruck oder Störungen des Fettstoffwechsels sein. Und obendrauf können Schwermetalle auch noch eine Dysbiose im Darm hervorrufen und uns durchs Hintertürchen noch mehr Schaden zufügen.
Die wichtigsten Schwermetalle für uns sind Arsen, Cadmium, Blei und Quecksilber und sie gelangen unter anderem durch Umweltverschmutzung, belastete Böden und Nahrungsmittel, zahnmedizinische Produkte in unserem Körper. Grundsätzlich können wir sie auch wieder ausscheiden, aber wenn wir zu viel aufnehmen und unsere Kapazität überfordern, reichern sie sich eben an.
Bevor sie das tun, passieren sie unseren Darm und können dort die Gesellschaft der Darmbakterien durcheinanderwirbeln.
Auch die Darmbakterien reagieren auf Schwermetalle
Forschende haben versucht, sich einen Überblick über den Einfluss verschiedener Schwermetalle auf die Darmbakterien zu verschaffen. Sie trugen die Ergebnisse zahlreicher Studien zusammen, die sich mit diesem Thema beschäftigten und kamen zu der Erkenntnis, dass Schwermetalle die Zusammensetzung des Mikrobioms stören und zu einer Dysbiose führen können. Außerdem ändert sich die Stoffwechselaktivität des Mikrobioms. Die Bakterien machen jetzt also andere Sachen, erledigen ihre Geschäfte auf andern Wegen. Es entstehen andere Metabolite, die sich anders auf ihre Umgebung, den Wirt, auswirken. Zellschäden, Entzündungen und Störungen der Darmbarriere können die Folge sein. Arsen, Blei, Cadmium und Quecksilber standen auf der Liste der Forschenden.
Alle
Mit der Ausnahmen von Cadmium führten alle Schwermetalle zu einer Anreicherung von Collinsella. Diese Bakterien gelten als Pathobionten und werden mit Leaky Gut, Entzündungen, Typ 2 Diabetes, Störungen des Cholesterinstoffwechsels sowie rheumatischer Arthritis in Verbindung gebracht.
Arsen
Arsen fördert die Vermehrung von Proteobakterien und Enterobakterien. Sie gehören ebenfalls nicht zu den gern gesehenen Darmbewohnern. Dafür kann es passieren, dass sich die gern gesehenen Bifidobakterien rarmachen.
Blei
Blei vermehrt pathogene Pilze, Hefen der Gattung Malassezia. Die
können zu allerlei Hautkrankheiten beitragen. Auch pathogene Bakterien, wie Bilophila oder Proteobakterien vermehren sich in Anwesenheit von Blei. Die guten Bifidobakterien nehmen dagegen ab.
Blei kann die Darmbarriere schädigen und dazu führen, dass Gallensäuren und bakterielle Metabolite verschiedene Stoffwechselfunktionen stören.
Quecksilber und Cadmium
Quecksilber und Cadmium im Darm stiften in erster Linie Verwirrung bei den Forschenden, weil die Ergebnisse hier sehr divergent sind.
Eine Studie zeigte, dass Quecksilber vor allem Actinobacteria, Desulfovibrio und Methanogene vermehrt. Methanogene sind gar keine Bakterien, sondern gehören zu den Archaeen. Die ähneln den Bakterien allerdings sehr und die Unterschiede in der Zellstruktur sind für Laien wohl uninteressant. Jedenfalls kristallisiert sich immer mehr heraus, dass viele von ihnen pathogen sind und Stoffwechselstörungen, Abszesse oder Krebs fördern. Manche von ihnen haben aber auch positive Eigenschaften. Desulfovibrio ist ein unerwünschtes Darmbakterium. Es trägt nicht nur zu Darmerkrankungen bei, sondern wird auch mit Parkinson in Verbindung gebracht. Actinobacteria gehören dagegen zu den Guten.
Quecksilber nehmen wir hauptsächlich mit Fisch auf. Es ist schon in geringen Dosen sehr giftig, weil es die Blut-Hirn-Schranke passieren und dort direkt seine Neurotoxizität entfalten kann. Aber auch die Methanogenen stehen im Verdacht, dem Nervensystem zu schaden.
Wie kann man sich vor Schwermetallen schützen?
Wahrscheinlich gar nicht. Sie sind überall, in Wasser, Luft, Böden. Aber eine gesunde Ernährung scheint sich gut auszuwirken. In den USA fand man eine negative Korrelation zwischen der Ballaststoffaufnahme und der Konzentration von Schwermetallen im Blut. Eisenmangel trägt viel zur Toxizität von Schwermetallen bei. Und zumindest bei Zebrafischen reduziert die Gabe von Zink die schädliche Wirkung von Cadmium.
Also empfehlen die Autoren des Übersichtsartikels reichlich Ballaststoffe, vor allem Weizenkleie und Pektin, reichlich Antioxidantien, wie sie in Obst und Gemüse vorkommen, Probiotika und bioaktive Peptide aus Fermentiertem, Mineralstoffe und Spurenelemente sowie ein moderater Fettkonsum zum Schutz vor Schwermetallvergiftungen und einer Dysbiose im Darm.
Und zu guter Letzt räumen sie noch ein, dass sie eigentlich nicht wirklich zu einem Schluss gekommen sind, weil die Erkenntnisse aus den Studien doch sehr heterogen sind. Unterschiedliche Proben von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, vor unterschiedlichen persönlichen Hintergründen und Lebensumständen und Unterschiede im Darm-Mikrobiom und die Suche nach unterschiedlichen Schwermetallen liefern eben solche Ergebnisse.
Trotzdem: Die Darmbakterien sind mal wieder dabei. Sie reagieren auf Schwermetalle in ihrer Umgebung, vermehren oder reduzieren sich, gehen andere Stoffwechselwege, hinterlassen andere Metabolite. Nicht nur deshalb sollte man das Thema Schwermetalle nicht außer Acht lassen.
Quelle:
Rezazadegan M, Forootani B, Hoveyda Y, Rezazadegan N, Amani R. Major heavy metals and human gut microbiota composition: a systematic review with nutritional approach. J Health Popul Nutr. 2025 Jan 27;44(1):21. doi: 10.1186/s41043-025-00750-4. PMID: 39871318; PMCID: PMC11773724.
Bild von Lucio Alfonsi auf Pixabay