Wenn es um ein gesundes Darm-Mikrobiom geht, ist immer wieder von Butyratbildner die Rede. Wer sind die und warum ist Butyrat so wichtig?
In unserem Darm leben mehrere Butyrat bildende Bakterien. Von rund 20 Arten ist die Rede. Die meisten gehören zum Stamm der Firmicutes, aber auch manche Actinobacteria, Bacteroidetes, Fusobacteria und Proteobacteria produzieren Butyrat. Zu den mengenmäßig wichtigsten Arten zählt Faecalibacterium prausnitzii, das sehr zahlreich im Darm vorkommt oder vorkommen sollte. Es stellt etwa 5 % der Bakterienpopulation, kann aber auch rund 15 % ausmachen. Auch Eubacterium rectale stellt mit rund 13 % eine mächtige Fraktion. Eubacterium hallii und Roseburia inestinalis machen noch je etwa 2,4 % der Darmbakterien aus.
Butyratbildner oder Moppel-Bakterien?
All diese wichtigen Butyratbildner sind Firmicuten, und manche eng mit den Clostridien verwandt, die einen eher schlechten Ruf haben. Genau wie Firmicutes insgesamt.
Ein hohes Verhältnis von Firmicutes: Bacteroidetes wird gerne als Indiz für schlechte Darmgesundheit angesehen. Ich verstehe das nicht so ganz, denn viele Firmicuten gehören zu den sehr erwünschten Darmbakterien, wie eben Butyratbildner, oder Milchsäurebakterien. Und Bakterien auf Stammesebene zu vergleichen ist, als würde man Vertebraten (Wirbeltiere) mit Arthropoden (Krabbelviechern) vergleichen. Sicher gibt es in beiden Stämmen beliebte und weniger beliebte Vertreter.
Ein hohes Verhältnis von Firmicutes: Bacteroidetes gilt auch als Indiz für Fettleibigkeit und da könnte schon was dran sein, denn Butyrat und andere kurzkettige Fettsäuren, die als Endprodukte der bakteriellen Fermentation von Ballaststoffen entstehen, können wir dann sehr wohl verwerten. Und damit werden die Butyratbildner tatsächlich zu Moppel-Bakterien.
Butyrat entsteht meist aus der Fermentation von Ballaststoffen, also für uns unverdaulichen Kohlenhydraten. Aber auch manche Aminosäuren aus Proteinen können zu Butyrat vergoren werden.
Was haben wir von Butyratbildnern?
Okay, Butyrat. Das war einfach. Aber warum ist Butyrat so eine tolle Sache? Butyrat ist eine kurzkettige Fettsäure und das sind die wichtigsten bakteriellen Stoffwechselprodukte in unserem Darm. Neben Butyrat entstehen noch Acetat und Propionat, je nachdem welchen Fermentationsweg die Bakterien einschlagen. Es entsteht übrigens doppelt so viel Acetat wie Butyrat oder Propionat. Aber Butyrat ragt deswegen hervor, weil es eine einzigartige Funktion erfüllt: Es nährt die Darmepithelzellen. Etwa 70 % der bakteriellen Produktion wird dort zur Energiegewinnung verbrannt. Was übrig ist, gelangt in den Blutkreislauf.
Zunächst gelangt Butyrat über die Pfortader in die Leber und dient dort zur Energiegewinnung. Was dann noch übrig ist, wird über die restlichen Gewebe verteilt und erfüllt andere Aufgaben, die auch nicht uninteressant sind. Butyrat hat zum Beispiel einen Nebenjob als Genregulator. So ein vielseitiges Molekül 🙂 .
Wir müssen Butyrat aber nicht von den Darmbakterien produzieren lassen. Theoretisch können wir es auch einfach essen.
Butyratbildner stabilisieren die Bakteriengemeinschaft in Darm
Wenn die Darmepithelzellen genug Butyrat zur Verfügung haben, sinkt durch ihre Stoffwechselaktivität der Sauerstoff im Darm und das verhindert das Wachstum von Bakterien, die den zur Energiegewinnung nutzen können. Das brächte denen einen enormen Vorteil, denn bei der aeroben Atmung, die sie dann durchführen könnten, rollt der Rubel gewaltig – in Form von ATP. Diese fakultativ anaeroben Bakterien sind oft Pathogene, Proteobakterien zum Beispiel.
Butyrat reguliert die Produktion von Cathelicidinen durch Immunzellen des Wirts. Das sind antimikrobielle Peptide. Außerdem greift Butyrat in die Sekretion von IgA ein. Immunglobulin A ist ein Antikörper, der eine wichtige Rolle im Immunsystem spielt und vor allem die Schleimhäute vor Krankheitserregern schützt. Es darf aber auch nicht überreagieren und die Kommensalen angreifen. Dafür sorgen die Butyratbildner.
Butyrat hemmt auch HDACs, Histondeacetylasen. Das sind Enzyme, die die Struktur der DNA bearbeiten und damit die Genaktivität beeinflussen. Dadurch sinkt die Produktion entzündungsfördernder Interleukine.
Butyrat stabilisiert die Darmbarriere
Die Darmbarriere besteht aus der Darmschleimhaut und dem Darmepithel. Die Schleimhaut ist zweischichtig, die äußere von Bakterien besiedelt, die in die innere in der Regel nicht vordringen können. Manche Schädliche schaffen das aber doch und reduzieren die Dicke der Schleimschicht. (Die nimmt übrigens auch ab, wenn wir synthetische Emulgatoren aus Industrienahrung zu uns nehmen.)
Zu den Schädlingen gehört Vibrio cholerae. Der produziert ein Enzym, das die Mucosa abbaut und ein Toxin, das die Tight Junctions, die Dichtungsringe zwischen den Zellen, angreift.
Clostridium perfringens, ein weiterer Schädling, greift ebenfalls die Tight Junctions mit einem Endotoxin an.
Wenn sowas passiert, stehen die Chancen gut, dass alles Mögliche einfach unkontrolliert an den Zellen vorbei in unseren Körper vordringt.
Aber Faecalibacterium fördert die Differenzierung zu schleimproduzierenden Becherzellen und steigert die Expression von Genen, die Zuckerreste an die schleimbildenden Proteine anheften. Das stärkt natürlich die Mucosa.
Butyrat fördert auf genetischer Ebene auch noch die Produktion der Proteine der Tight Junctions.
Bei manchen Krankheiten fehlen Butyratbildner
Bei Colitis ulcerosa, einer entzündlichen Darmerkrankung, mangelt es typischerweise an Faecalibacterium und Roseburia.
Neben Roseburia und Faecalibacterium mangelt es bei Darmkrebs auch an Clostridiales und Angehörigen der Familie Lachnospiraceae. Der Mangel an Butyrat hebt wahrscheinlich dessen entzündungshemmende Wirkung auf und macht den Weg für onkogene Stoffwechselwege frei.
Manche Butyratbildner, vor allem Roseburia, setzen Linolsäure zu konjugierter Linolsäure, CLA, um. Die fördert die Apoptose, den „programmierten Zelltod“ und wirkt dadurch antikanzerogen.
Achsen allüberall
Zwischen dem Darm und verschiedenen Organen bestehen Achsen, über die die beteiligten Gewebe miteinander kommunizieren: Eine Darm-Hirn-Achse, und eine mit Lunge, Leber, Nieren, Herz, Haut, Augen, was auch immer.
Die Darm-Hirn-Achse ist schon lange bekannt und gut untersucht. Man weiß, dass Darmbakterien die Produktion eines Rezeptors, AhR, fördern und Butyrat ist eines der Moleküle, die ihre Botschaften an ihn weitergeben.
Wenn dann der Stoffwechsel im Kopf in Schieflage kommt, fehlt es oft an Butyratbildnern, wie Butyricimonas, Coprococcus und Faecalibacterium. Manche Butyratbildner produzieren auch Serotonin. Das hält den Darm in Bewegung, ist aber auch das Glückshormon, das bei Depressionen fehlt. Es gelangt möglicherweise über den Vagusnerv vom Darm ins Gehirn.
Die Leber erhält einen Großteil des ihr zu verarbeitenden Blutes aus dem Darm. Macht ja auch Sinn, schließlich muss die Beute verarbeitet werden. Bei alkoholbedingten Leberschäden mangelt es oft an Anaerostipes, Coprococcus und Roseburia aus der Familie der Lachnospiraceae, bei nichtalkoholischer Fettleber an Faecalibacterium.
So kann man Butyratbildner füttern
Es gelangen täglich auch ein paar Gramm Protein in den Dickdarm. Das könnten wir auch verwerten. Aber grundsätzlich leben die Darmbakterien von dem, was wir nicht kleinkriegen. Das sind Ballaststoffe, meist unverdauliche Kohlenhydrate. Aber auch Polyphenole, sekundäre Pflanzenstoffe, dienen manchen Bakterien als Nahrung.
Faecalibacterium, Roseburia und Ruminokokken vermehren sich, wenn man sie mit Polyphenolen füttert. Das kann alles Mögliche sein. Catechine aus Grüntee, Anthocyan, der beinahe universelle Pflanzenfarbstoff, der unter vielem anderem Rotkohl und Zwetschgen färbt. Dann wären da noch Rutin (z.B. in Buchweizen oder Petersilie), Kaffeesäure (Kaffee, Obst, Rüben, Knollen) oder Chlorogensäure (u.a. Kaffee, geht aber beim Rösten weitgehend verloren, Kartoffeln, Brennnesseln). Auch sie fördern die Produktion von Butyrat im Darm.
Die Ballaststoffe, die zu den unverdaulichen Kohlenhydraten gehören, sind kompliziert verknüpfte, große Moleküle, die nicht von allen Bakterien gespalten werden können. Da ist es hilfreich, sich möglichst abwechslungsreich zu ernähren, damit jedes Mal zum Zug kommt, zumindest, solange man nicht weiß, mit welchem Präbiotikum man welches Bakterium selektiv anreichern kann. Also immer schön bunt essen…
Quelle:
Singh V, Lee G, Son H, Koh H, Kim ES, Unno T, Shin JH. Butyrate producers, „The Sentinel of Gut“: Their intestinal significance with and beyond butyrate, and prospective use as microbial therapeutics. Front Microbiol. 2023 Jan 12;13:1103836. doi: 10.3389/fmicb.2022.1103836. PMID: 36713166; PMCID: PMC9877435.
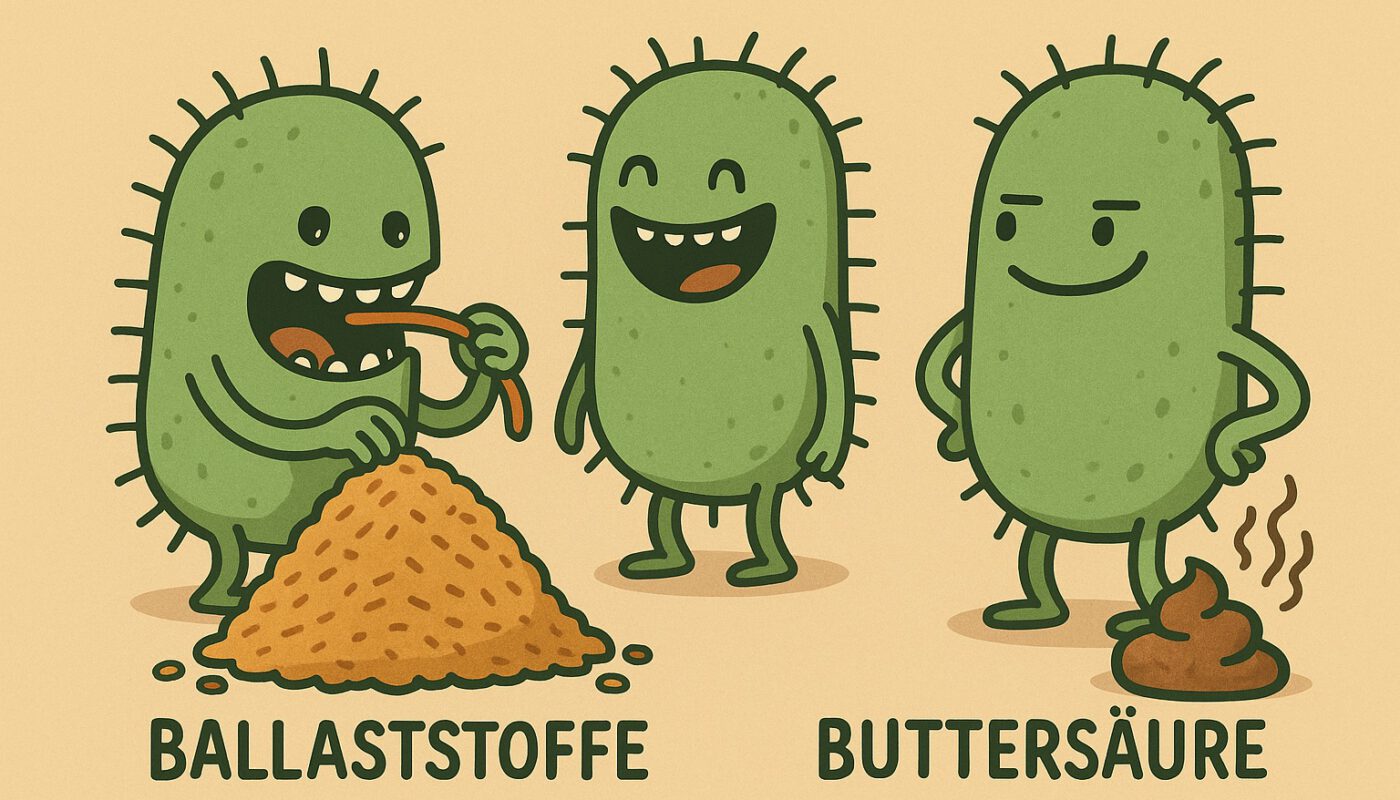



Ein Gedanke zu „Wer sind eigentlich diese Butyratbildner?“